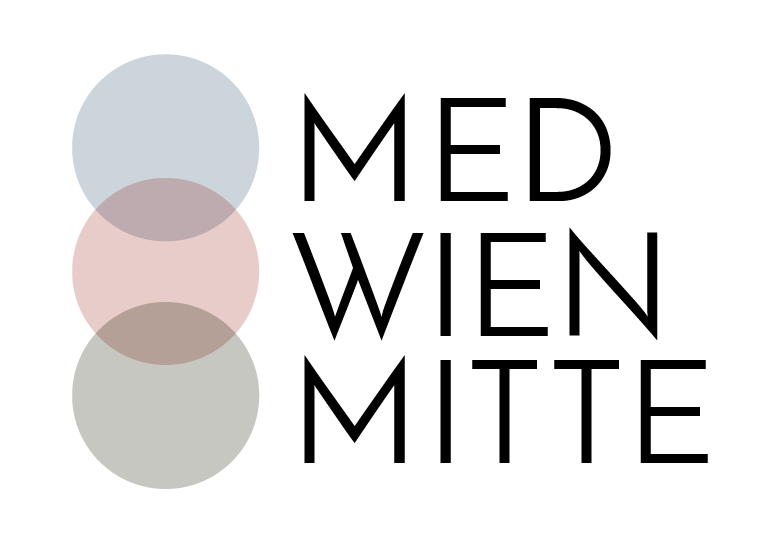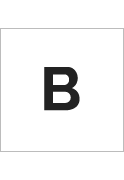Was versteht man unter Refluxerkrankung?
Der Magensaft ist stark sauer und die Schleimhaut der Speiseröhre ist nicht ausreichend vor der Exposition mit der Magensäure geschützt. Der Kontakt von Magensaft mit der Speiseröhre kann Sodbrennen verursachen und in weiterer Folge zu einer Entzündung in der Speiseröhre führen (Refluxösophagitis). Bei manchen PatientInnen kann sich die Refluxerkrankung auch als chronischer Husten, Asthma oder chronische Kehlkopfentzündung äußern.
Manchmal bestehen auch nur Schluckbeschwerden, oder PatientInnen klagen über einen sauren oder salzigen Geschmack im Mund. Die Refluxerkrankung wird auch als gastroösophageale Refluxkrankheit (im Englischen: gastroesophageal reflux disease – GERD) bezeichnet.
Welche operative Behandlung der Refluxerkrankung gibt es?
Die am häufigsten eingesetzt Operationsmethode ist die sogenannte Fundoplikatio. Bei diesem Eingriff wird versucht die Funktion des unteren Speiseröhrenmuskels so gut wie möglich wiederherzustellen. Drei Operationsziele sind dabei wesentlich: Eine vorhandener Zwerchfellbruch wird durch mehrere Nähte eingeengt und gegebenenfalls durch das Einbringen eines Kunststoffnetzes verstärkt, der Bereich des unteren Speiseröhrenschließmuskel wird wieder in den Bauchraum verlagert und ein Teil des Magens wird um die Speiseröhre gelegt, um den Schließmuskel zu verstärken.
Bringt eine robotische Operation Vorteile?
Die Operation wird fast immer in minimal invasiver Technik (Schlüssellochchirurgie) oder auch unter Einsatz eines Operationsroboters durchgeführt. Bei komplexen Eingriffen kann der Operationsroboter die Operation erleichtern.




Univ.Doz.Dr. Sebastian Roka
Facharzt für Allgemein-, Viszeral-, und Gefäßchirurgie
Leiden Sie unter Sodbrennen?
Eine Behandlung nach den modernsten medizinischen Erkenntnissen ist entscheidend für den Behandlungserfolg. Ich bemühe mich, Ihnen die Vor- und Nachteile der therapeutischen Optionen zu erläutern, um dann gemeinsam Ihren individuellen Therapieplan zu erstellen. Profitieren Sie von meiner langjährigen Erfahrung in der Viszeralchirurgie und insbesondere der minimal invasiven Chirurgie und Roboterchirurgie.
Was sind die Ursachen für eine Refluxerkrankung?
Die Refluxerkrankung kann durch viele Umstände verursacht werden. Übergewicht, Nikotin, Alkohol und der häufige Genuss von zucker- und fettreicher Kost können die Entstehung begünstigen. Die häufigste Ursache für eine Refluxerkrankung ist jedoch das Vorliegen eines Zwerchfellbruchs.
FAQ
Ihre Fragen – meine Antworten zur Refluxerkrankung
Was ist eine Zwerchfellbruch?
Das Zwerchfell ist der Atemmuskel, der den Brustkorb vom Bauchraum trennt. Die Speiseröhre tritt durch eine präformierte Lücke des Zwerchfells, den sogenannten Hiatus oesohageus. Bei Gesunden ist die Lücke gerade so groß, dass die Speiseröhre durch die Muskelschenkel des Zwerchfells eng umfasst ist. In diesem Zustand arbeiten das Zwerchfell und der untere Schließmuskel der Speisröhre zusammen und verhindern, dass Mageninhalt in die Speiseröhre zurückfließen kann. Kommt es zu einer Erweiterung dieser Lücke nennt man dies Zwerchfellbruch oder Hiatushernie. Die Barriere gegen den Reflux von Mageninhalt ist dabei meist gestört, sodass Refluxbeschwerden auftreten können.
Können bei Refluxerkrankung Komplikationen auftreten?
Am häufigsten kommt es zu entzündlichen Veränderungen in der unteren Speiseröhre, die Refluxösophagitis genannt wird. Seltener kommt es zur Entstehung eines Ulkus in der Speiseröhre. Narbige Veränderungen oder gar Engstellen treten erst nach langjähriger Anamnese auf.
Bei lange anhaltender Refluxerkrankung kann es passieren, dass die Schleimhaut in der Speiseröhre versucht sich anzupassen und ihre Struktur ändert. Man spricht dann von einer Barrett-Mukosa. Bei fortbestehender Entzündung kann diese entarten und das Risiko eines Speiseröhrenkrebs (Ösophaguskarzinom) ist bei Vorliegen einer Barrett-Mukosa leicht erhöht.
Wie kann ich herausfinden, ob ich Refluxbeschwerden habe?
Der erste Schritt ist die genaue Anamneseerhebung durch einen erfahrenen Mediziner, der die Verdachtsdiagnose bereits erhärten kann. Dabei sind die Umstände (Stress, bestimmte Ernährungsgewohnheiten) und Häufigkeit der Beschwerden von Bedeutung. Zur endgültigen Diagnosesicherung sind dann weitere Untersuchungen erforderlich.
Welche Untersuchungen sind bei Refluxbeschwerden notwendig?
Bei einer Gastroskopie können ein Zwerchfellbruch oder auch eine Refluxöophagitis bereits erkannt werden. Biopsien können die Diagnose histologisch bestätigen.
Bei einer sogenannten pH-Metrie wird der pH-Wert in der Speiseröhre über 24 Stunden gemessen. Das Ausmaß der Refluxerkrankung kann mit dieser Untersuchung bestimmt werden. Wichtig ist auch, ob die Beschwerden der Patienten mit den Refluxepisoden zusammentreffen. Eine hohe Symptomkorrelation bedeutet auch eine hohe Chance auf eine erfolgreiche chirurgische Therapie.
In manchen Fällen kann zusätzlich eine Messung des Drucks des unteren Speiseröhrenmuskels (Manometrie) zur Planung der operativen Therapie notwendig sein.
Kann ich selbst etwas gegen Reflux tun?
Eine Änderung der Lebensgewohnheiten kann helfen die Symptome zu bessern. Die Vermeidung von Alkohol, Nikotin und zucker- oder fetthaltigen Speisen bringt oft eine deutliche Besserung. Bei nächtlichen Refluxbeschwerden kann es helfen den Oberkörper im Schlaf hochzulegen und die Abendmahlzeit mehrere Stunden vor dem Schlafengehen einzunehmen. Bereits eine geringe Gewichtsreduktion senkt rasch den Druck im Bauchraum und kann die Refluxbeschwerden damit ebenso deutlich bessern.
Kann Reflux auch ohne Operation behandelt werden?
Sollten Anpassungen des Lebensstils nicht helfen, kann die Produktion der Magensäure medikamentös unterdrückt werden. Sogenannte Protonenpumpeninhibitoren (PPI) sind die wirksamste Therapie, da sie die Produktion der Magensäure fast vollständig unterdrücken. Der Reflux wird zwar nicht verhindert, aber durch das Fehlen der Magensäure werden keine Symptome mehr verursacht. Andere Medikamente kommen heute nur mehr selten zum Einsatz.
Kontakt
Wahlärzte
Keine Kassen
Hinweis: Die Ordination ist nicht barrierefrei. Die Ordination befindet sich im Mezzanin, kein Aufzug vorhanden.
Direkt bei Wien Mitte! Der Verkehrsknotenpunkt Wien Mitte (U1, U3, U4, S-Bahn) ist nur 2 Minuten fußläufig entfernt.

Dr. Ursula Pleil
Ordinationsassistentin
Was ist ein Wahlarzt?
Die Bezeichnung „Wahlarzt“ leitet sich aus dem gesetzlichen Recht des Versicherten (Patienten) ab, sich seinen Arzt frei wählen zu können.
Als Wahlärzte haben wir keinen Vertrag mit den Krankenkassen. Das heißt, dass Sie unsere Leistungen nicht mit der e-card in Anspruch nehmen können und die Verrechnung jeder Untersuchung und Behandlung direkt mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin erfolgt. Durch Einreichen der Honorarnote bei Ihrer gesetzlichen Krankenkasse wird Ihnen in einem zweiten Schritt ein Teil des bezahlten Honorars rückerstattet.
Sollten Sie eine Privatversicherung („Zusatzversicherung“) für ambulante Leistungen abgeschlossen haben, wird von der Privatversicherung gemäß den vertraglichen Versicherungsbedingungen der Differenzbetrag zwischen Kassentarif und Privathonorartarif bzw. auch das gesamte Privathonorar refundiert.